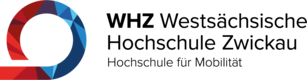Nachlese: Vielfältig Gärtnern!

Am Samstag, dem 19.10.24 fand die Veranstaltung (Transferzentrum für Biodiversität) „Vielfältig Gärtnern! – Artenvielfalt in Kleingärten“ am Campus Pillnitz der HTWD statt. Diese wurde gemeinsam vom Biozentra und der Sächsischen Gartenakademie des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie organisiert.
Eine grüne Wohltat für Mensch, Tier und Pflanze
Ein angestaubtes Image, kitschige Gartenzwerge und fehlender Nachwuchs – diese Zeiten sind vorbei! In Dresden erlebt die Gartenszene einen Aufschwung. Besonders junge Menschen und Familien entdecken Kleingartenanlagen als erschwingliche Möglichkeit, ihren Traum vom eigenen Garten zu verwirklichen – gerade in Zeiten steigender Wohn- und Baupreise.
Doch Kleingärten bieten nicht nur Erholung vom stressigen Alltag, Gemeinschaft und die Chance, frisches Obst und Gemüse anzubauen. Sie spielen auch eine bedeutende Rolle für die Dresdner Stadtnatur. Kleingärten tragen zum Stadtklima bei, verbessern die Luftqualität und schaffen Lebensraum für zahlreiche Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen.
Welche Bedeutung haben Kleingärten für die Artenvielfalt in der Stadt? Und wie können Gärtner*innen ihre Gärten so gestalten, dass sie heimische Arten wie Vögel, Wildbienen oder Schmetterlinge fördern? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Veranstaltung „Vielfältig Gärtnern!“.
Von der Wissenschaft direkt in den Garten!

An einem herbstlichen Samstagmorgen trafen sich rund sechzig Garteninteressierte am Campus Pillnitz, begrüßt mit heißem Kaffee oder Tee. Nach einem ersten Austausch und herzlichen Begrüßungen eröffnete Moderatorin Sylvi Piela, professionelle Moderatorin und Vorsitzende des Kleingartenvereins Laubenheim, die Veranstaltung. Anschließend übergab sie das Wort an Prof. Dr. Katrin Salchert, Rektorin der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden.
In ihrer Rede betonte Prof. Dr. Salchert die Herausforderungen des Klimawandels, die in Städten durch versiegelte Flächen und hohe Gebäude verstärkt werden. Gleichzeitig hob sie den dramatischen Rückgang der Artenvielfalt hervor, der oft unbemerkt bleibt. Städte, so Salchert, bieten trotz allem wichtige Ersatzlebensräume für viele Arten. Doch auch diese Lebensräume schwinden. Kleingartenanlagen könnten daher sowohl zur Verbesserung des Stadtklimas als auch zur Förderung der Artenvielfalt einen entscheidenden Beitrag leisten.
Die Hochschule trage ihren Teil bei, indem sie Artenkenner und Umweltplaner ausbilde und angewandte Forschung betreibe – etwa zur Bedeutung von Kleingärten für die biologische Vielfalt. Ein wichtiges Anliegen sei es, dieses Wissen durch Projekte wie das BIOZENTRA auch der Gesellschaft zugänglich zu machen.
Artenvielfalt im Kleingarten unter der Lupe
Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr. Arne Cierjacks, Dekan der Fakultät Landbau/Umwelt/Chemie und Leiter des BIOZENTRA. Er stellte Ergebnisse von Untersuchungen zur Artenvielfalt in Dresdner Kleingärten vor. Dabei wurden verschiedene Artengruppen wie Tagfalter, Laufkäfer und Pflanzen analysiert. Die Ergebnisse zeigten: Kleingärten sind artenreicher als Stadtparks, erreichen jedoch nicht die Vielfalt von Brachen. Somit trögen sie als wichtiger Teil der urbanen Grünen Infrastruktur zur Biodiversität bei, insbesondere, wenn man die Kleingärten vielfältig, strukturreich und ökologisch gestalte.


Was es bei der ökologischen Gestaltung zu beachten gibt
Bei der Gestaltung von Kleingärten gibt es klare Regeln, die insbesondere die Auswahl bestimmter Gehölze und die Nutzung der Flächen betreffen. Diese Vorgaben sind im Bundeskleingartengesetz sowie in der Rahmenkleingartenordnung festgelegt. Nicole Kramer, Fachberaterin des Stadtverbands „Dresdner Gartenfreunde“ e. V., erläuterte in ihrem Vortrag die wichtigsten Aspekte und veranschaulichte diese anhand von Best- und Worst-Practice-Beispielen.
Ein zentraler Punkt ist die Minimierung von Versiegelungen und die Beschränkung von Bauten im Kleingarten auf ein notwendiges Maß. Frau Kramer betonte, dass ein guter Kleingarten nicht nur den Vorgaben entsprechen, sondern auch durch die ökologische Gestaltung die biologische Vielfalt fördern sollte.
Sie merkte an, dass die Gestaltung nach Permakulturprinzipien grundsätzlich eine gute Idee sei, jedoch mit einigen Herausforderungen verbunden ist. Viele unterschätzen den hohen Wissensbedarf, der für eine effektive Umsetzung notwendig ist. Zudem erschwert die Permakultur die Einhaltung der Flächennutzungsvorgaben, die im Kleingarten genau geregelt sind. Daher empfiehlt es sich, bei einer geplanten Umgestaltung frühzeitig das Gespräch mit dem Vorstand des Kleingartenvereins oder dem Stadtverband zu suchen. Dieser Austausch hilft dabei, eine ökologische und zugleich regelkonforme Gestaltung des Gartens zu realisieren.
Wie man Wildbienen im Kleingarten fördern kann
Wer beim Begriff „Bienensterben“ an die Honigbiene denkt, liegt falsch. Die Honigbiene ist ein Nutztier, vergleichbar mit Rindern oder Hausschweinen. Das eigentliche Problem betrifft die etwa 560 Wildbienenarten, die in Deutschland heimisch sind. Mehr als die Hälfte dieser Arten sind inzwischen bestandsgefährdet. Doch wie kann ein Kleingarten gestaltet werden, um Wildbienen und die heimische Insektenvielfalt zu fördern? Diese Frage stand im Fokus des Vortrags von Annett Römer, Leiterin des Projekts BienenBrückenBauen (BBB) am Umweltzentrum Dresden e. V.
Wildbienen haben unterschiedliche Ansprüche an Pollen- und Nektarquellen. Daher empfiehlt es sich, im Kleingarten eine große Vielfalt an heimischen Pflanzenarten anzubauen. Auch vermeintliches „Unkraut“ sollte hin und wieder einfach wachsen dürfen, da es wichtige Nahrung für Wildbienen bieten kann. Beim Kauf von Pflanzen sei Vorsicht geboten: Viele im Handel angebotene Sorten, selbst von heimischen Pflanzenarten, wurden züchterisch verändert. Beispielsweise sind gefüllte Blüten oft für Wildbienen unbrauchbar, da sie keinen zugänglichen Nektar mehr bieten.
Darüber hinaus bietet ein gepflegter, kurz geschnittener Rasen Wildbienen kaum Lebensraum. Eine Umwandlung in eine extensiv gemähte Blumenwiese schafft hingegen wertvolle Flächen für Insekten. Beim Mähen sollte immer ein Teil der Wiese stehen bleiben, um ein Refugium zu bieten.
Möchten Sie mehr erfahren? Frau Römer und ihr Team bieten regelmäßig Workshops und Vorträge an. In diesen Veranstaltungen können Sie lernen, wie Sie beispielsweise Nisthilfen für Wildbienen im Garten richtig anlegen und welche Pflanzen Wildbienen besonders fördern.
Mit diesen Maßnahmen kann jeder Garten zu einem wertvollen Lebensraum für Wildbienen und andere Insekten werden – ein wichtiger Schritt, um der Bedrohung der Artenvielfalt entgegenzuwirken.


Führungen von der Gartenakademie des LfULG
Im Anschluss an den Vortrag fand eine Diskussionsrunde statt, bei der das Publikum die Möglichkeit hatte, Fragen an die Referent*innen zu stellen. Die angeregten Gespräche boten Raum für den fachlichen Austausch und die Klärung praktischer Fragen. Beim darauffolgenden gemeinsamen Mittagessen wurden neue Kontakte geknüpft und Ideen diskutiert, wie die vorgestellten Ansätze zur Förderung der biologischen Vielfalt möglichst vielen Kleingärtnerinnen und Gartenbesitzerinnen zugänglich gemacht werden können.
Den Abschluss der Veranstaltung bildeten zwei verschieden Führungen aus denen die Tagungsteilnehmer wählen konnten durch die Versuche mit klimaresilienten Stauden oder durch die wildbienenfreundlich gestaltete Anlage des Zentrums für Insektenvielfalt und Imkerei des sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie von Frau Anja Seliger, Frau Kerstin Viehwegieger von der Sächsischen Gartenakademie und Herrn Georg Braunsdorf, Leiter des Referats Garten- und Landschaftsbau der Abt. Gartenbau.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Referent*innen für ihre erkenntnisreichen Vorträge und Führungen sowie den Gästen für ihre Teilnahme und die rege Beteiligung an der fachlichen Diskussion. Gemeinsam wurden wichtige Impulse für die ökologische Gestaltung von Gärten gesetzt!
veröffentlicht am 10.12.2024, von Nico Beier
Zeitraum
19.10.2024
Ort
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Campus Pillnitz Dresden
Pillnitzer Platz 1
01326 Dresden
Veröffentlichungsdatum
10.12.2024
Kontakt

Nico Beier, M. Sc.
Schlagwörter
Führung, Tagung, Wissenschaftskommunikation, Wissenstransfer