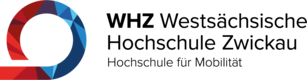Forschung für gesunde Flüsse – HTW Dresden untersucht Vjosa

Wie kann der Schutz natürlicher Gewässer und ihrer Ökosysteme gelingen? Mit dieser Frage beschäftigten sich Studierende und Forschende der HTW Dresden im Rahmen einer internationalen Sommerschule an der Vjosa, einem der letzten weitgehend unberührten Flüsse Europas. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie praxisorientierte Forschung, internationale Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung ineinandergreifen.
Interdisziplinäre Forschung an Europas letztem wilden Fluss
Die diesjährige Sommerschule wurde von der Fakultät für Landbau, Umwelt und Chemie der HTW Dresden unter Leitung von Prof. Dr. Kathrin Harre und Prof. Dr. Arne Cierjacks gemeinsam mit Partner*innen aus Tirana (unter Leitung von Prof. Dr. Sajmir Beqiraj) organisiert. Nach einem ersten Treffen vor Ort im März diesen Jahres wurde es im September ernst: Zehn Tage, zwanzig Studierende, zehn Betreuende, ein Wildfluss.
Im Feld wurden Kartierungen durchgeführt, Wasser- und Bodenproben entnommen und umfangreiche Daten zur Plastikbelastung erhoben. Insgesamt wurden rund 240 kg Probenmaterial gesammelt, das nun wissenschaftlich ausgewertet wird.
Drohnenbefliegungen lieferten hochauflösende Geländemodelle, und digitale Verfahren ergänzten traditionelle Kartierungstechniken. Die Arbeiten wurden begleitet von Prof. Dr. Danilo Schneider (Photogrammetrie, HTW Dresden).

„Mit der Vjosa verbinden wir nicht nur ein einzigartiges Ökosystem, sondern auch die großen Fragen unserer Zeit: Plastikverschmutzung und die Belastung der Umwelt durch Mikroplastik. Dazu haben wir an der HTWD in den vergangenen Jahren eine fundierte Expertise aufgebaut. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnern in Albanien zeigt, wie Wissenschaft Verantwortung über Grenzen hinweg übernimmt.“
– Prof. Dr. Kathrin Harre
Bedeutung für Naturschutz und Forschung
Der Zeitraum der Exkursion fiel in eine wegweisende Phase: Mit der Einführung der Norm DIN EN ISO 24187:2023 wurde erstmals ein standardisiertes Verfahren zur Messung von Mikroplastik im Trinkwasser etabliert. Parallel dazu wurde das Vjosa-Tal in das UNESCO-Programm „Der Mensch und die Biosphäre“ aufgenommen und erhält damit weiteren internationalen Schutz.

„Die Vjosa ist ein Lehrbuchbeispiel für die Dynamik von Flussauen. Hier wird deutlich, wie eng Biodiversität, Wasserqualität und menschliche Eingriffe miteinander verbunden sind. Für uns war es beeindruckend zu erleben, wie wissenschaftliche Arbeit und globaler Naturschutz ineinandergreifen“
– Prof. Dr. Arne Cierjacks
Lernen, Forschen und Verbindendes Miteinander
Die Sommerschule steht für die enge Verzahnung von Lehre, Forschung und internationalem Austausch. Studierende und Promovierende aus Dresden und Tirana haben mit großem Engagement zur Datenerhebung beigetragen und wertvolle Praxiserfahrungen gesammelt. Viele Teilnehmende sehen die Exkursion als eine prägende Lernerfahrung – nicht nur wissenschaftlich, sondern auch persönlich.
In sechs verschiedenen albanisch-deutschen Teams haben sich die Studierenden und Betreuenden den Themen Geoinformatik / Fernerkundung, Mikroplastik, Makroplastik, Vegetation, Makrozoobenthos und Algen gewidmet. Pauline Seidel, Mitorganisatorin, beschreibt die Ziele der Summerschool wie folgt: „Wir möchten besser verstehen, wie Mikro- und Makroplastik in einem weitestgehend ungestörten Fluss transportiert werden, welche Rolle dabei das Mikrorelief (also Erhebungen und Vertiefungen auf kleinem Raum) spielt und wie Vegetationsbestände beschaffen sein müssen, damit Plastik aus dem Fluss entfernt werden kann.“
Daneben haben sich zwei Gruppen vertieft damit auseinandergesetzt, Aussagen über den aktuellen Biodiversitäts-Status der Vjosa treffen zu können. Besonders beeindruckend war die Motivation der mitgereisten Studierenden, selbst nach schweißtreibenden langen Tagen der Geländearbeit bei 30 °C im Flussbett abends noch Daten zu digitalisieren und zu diskutieren und sich an der Organisation zu beteiligen. „Ich bin echt stolz, wie motiviert und mit wie viel Einsatz die Studierenden Feldarbeiten durchgeführt haben und dass sie erkannt haben, worum es geht.“, so Mitorganisatorin Xhoen Gjashta.
Am Ende wurden knapp 5.000 km mit dem HTW-Bus zurückgelegt, 120 Sediment- und Bodenproben genommen, 60 Probenahmepunkte vermessen, 10 Transekte beprobt und vermutliche die ein oder andere grenzüberschreitende Freundschaft geschlossen.
veröffentlicht am 05.11.2025, von Eric Neiß